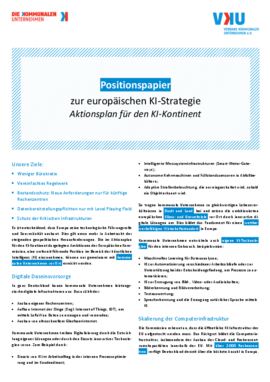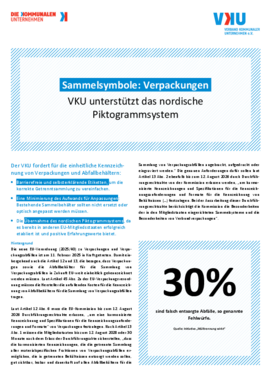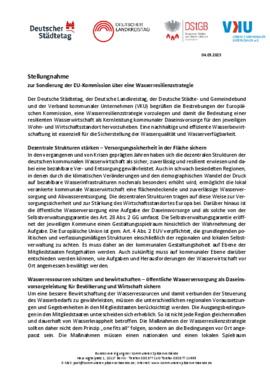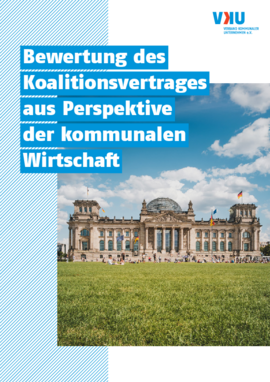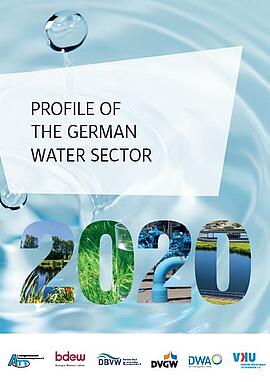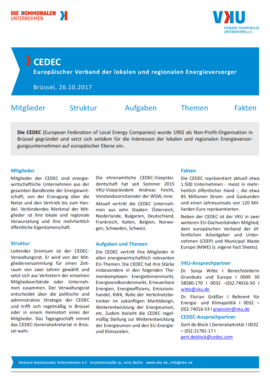moonrun/stock.adobe.com
Europa
Eine starke kommunale Selbstverwaltung mit starken kommunalen Unternehmen setzen eine europäische Gesetzgebung erfolgreich um.
Wir leben Europa
Die europäische Gesetzgebung bildet den Rahmen für fast alle kommunalwirtschaftlichen Tätigkeiten. In der EU ist das deutsche Kommunalsystem nahezu einzigartig. Es zeigt sich, dass es vor allem die kommunale Selbstverwaltung mit starken Kommunen und kommunalen Unternehmen ist, die die europäische Gesetzgebung erfolgreich umsetzt – in der Wirtschaft, im Binnenmarkt und Umweltsektor. Hier ist Deutschland europaweit führend. Um die Interessen und Belange der rund 1.500 Mitgliedsunternehmen auch auf europäischer Ebene stark zu vertreten, unterhält der VKU ein Europabüro in Brüssel.
Das VKU-Büro in Brüssel stellt sich und seine Arbeit vor
Was macht der Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) eigentlich in Brüssel? Das Video gibt einen Einblick in unsere Arbeit auf europäischer Ebene.

VKU-Positionen
Mehr zu VKU-PositionenAktuelle Beiträge
Mehr zu Aktuelle BeiträgePublikationen
Mehr zu PublikationenNetzwerk VKU-DU in Brüssel
Mit dem Netzwerk VKU-DU adressiert der Verband junge Menschen aus seiner Mitgliedschaft. Es soll sie in den ersten Berufsjahren begleiten, sie zusammenbringen und mit ihnen zu ihren Themen über ihre Kanäle im Dialog sein. Im Film zeigen wir das Netzwerk-Treffen in Brüssel.