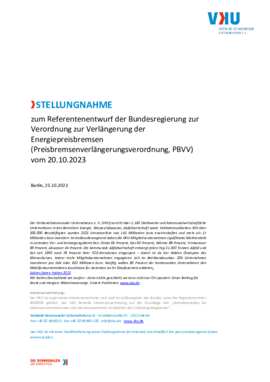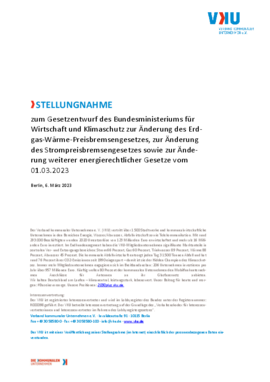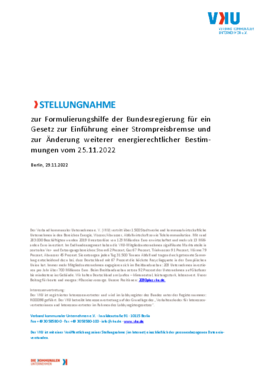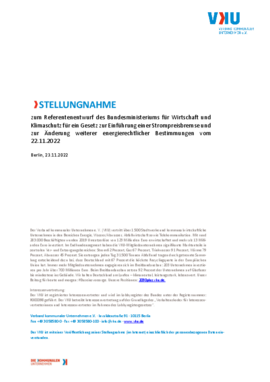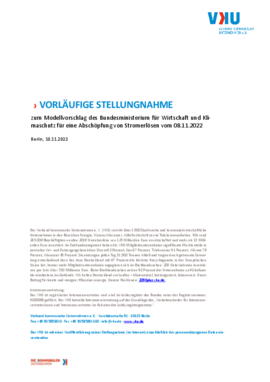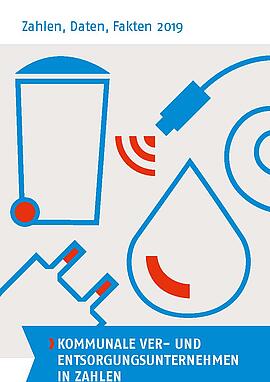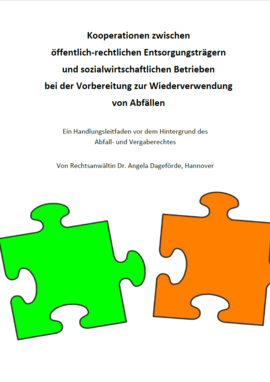Lukas Gojda/stock.adobe.com
Recht
Kommunale Unternehmen erfüllen einen öffentlichen Zweck. Aus ihrer Nähe zur öffentlichen Hand ergeben sich besondere Sorgfalts- und Handlungspflichten.
Wir arbeiten legal und transparent
Von A(bfallrecht) bis Z(ivilrecht), die kommunalen Unternehmen müssen eine Vielzahl von europäischen und nationalen Rechtsvorschriften beachten und anwenden. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen werden stetig komplexer. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Die hohe Regelungsdichte in Form von Gesetzen, Verordnungen und Festlegungen sowie deren Auslegung durch die Rechtsprechung prägen das Tagesgeschäft aller kommunalen Unternehmen und erfordern eine hohe rechtliche Kompetenz.
Exklusive Inhalte für Mitglieder
Sollten Sie noch nicht im VKU-Mitgliederbereich registriert sein, rufen Sie bitte folgenden Link zur Registrierung auf: