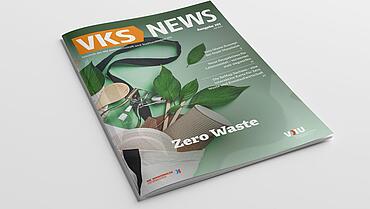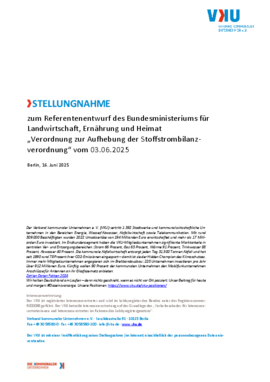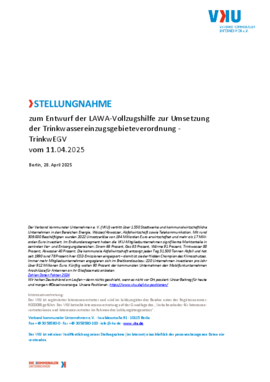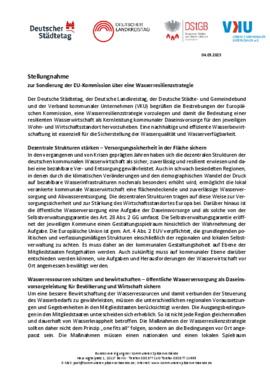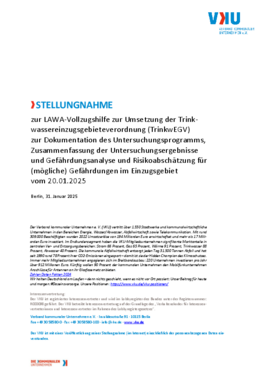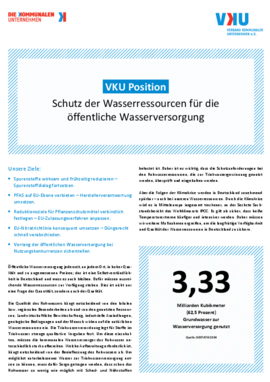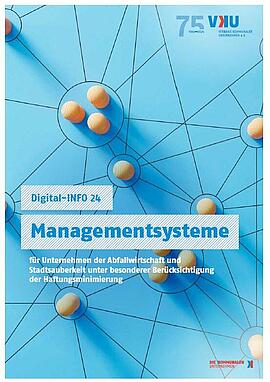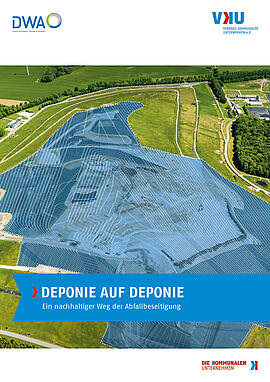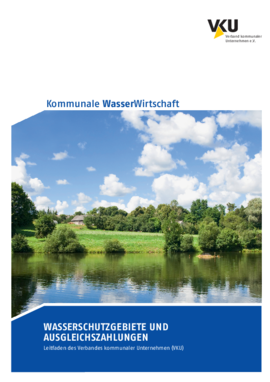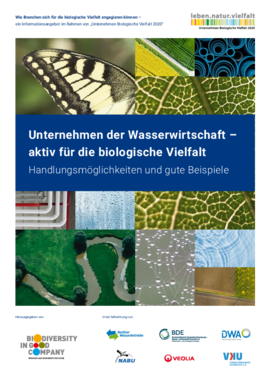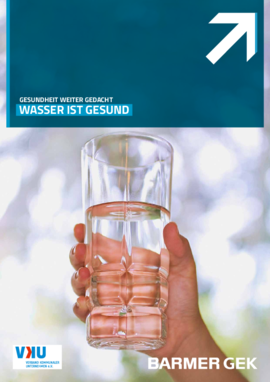Smileus/stock.adobe.com
Umwelt
Kommunale Unternehmen gestalten mit den Kommunen Klimaschutz vor Ort. Nachhaltigkeit gehört zu ihrem Selbstverständnis.
Wir handeln umweltbewusst
Die nachhaltige Nutzung von Ressourcen wie Wasser und Wertstoffen sowie der Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien sind für kommunale Unternehmen Chance und Verpflichtung zugleich. Schon heute sorgen sie dafür, dass erneuerbare Energien schrittweise und dauerhaft in das Energiesystem integriert werden und dabei bezahlbar bleiben. Kommunale Wasser-, Abwasser- und Abfallunternehmen setzen auf eine permanente energetische Optimierung ihrer Anlagen und Prozesse.