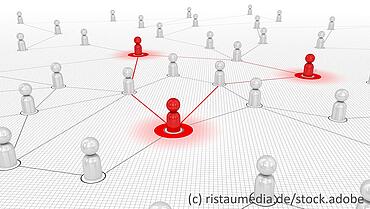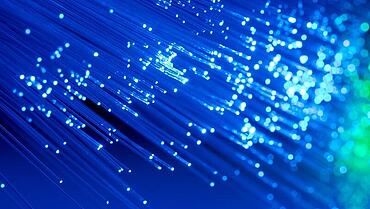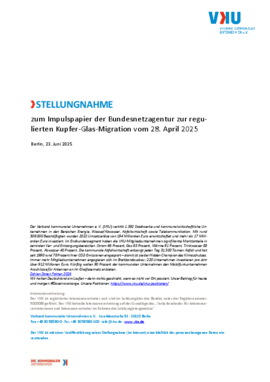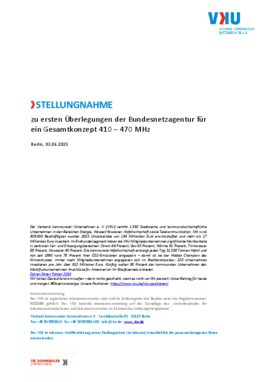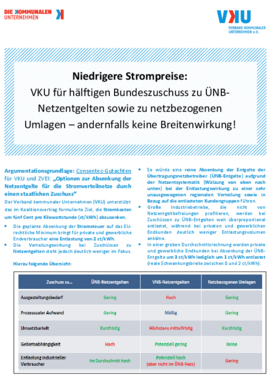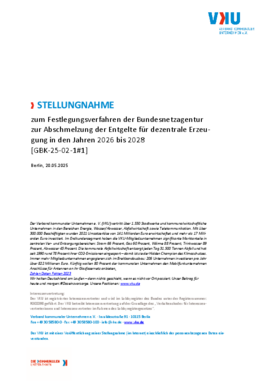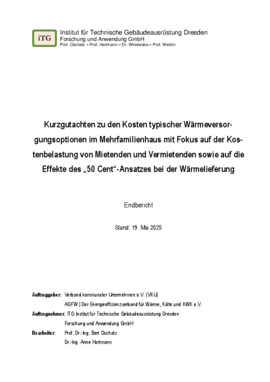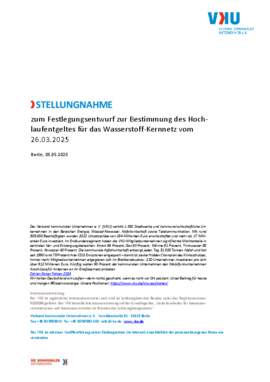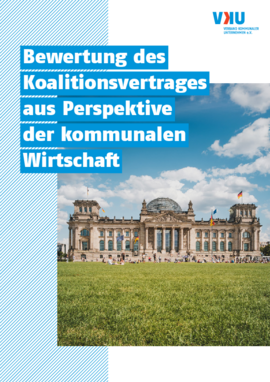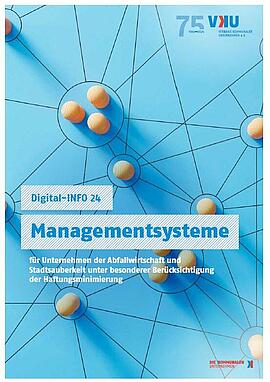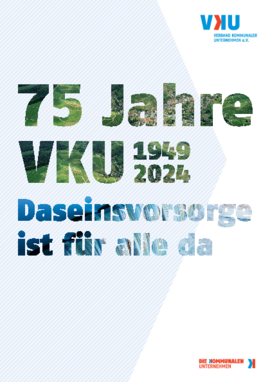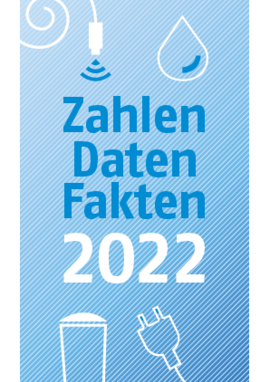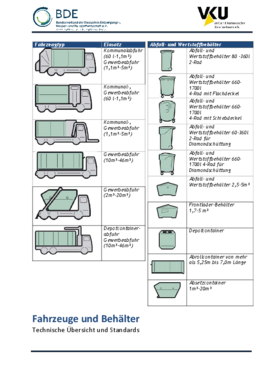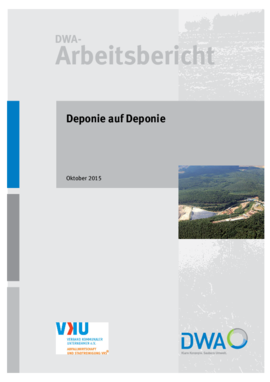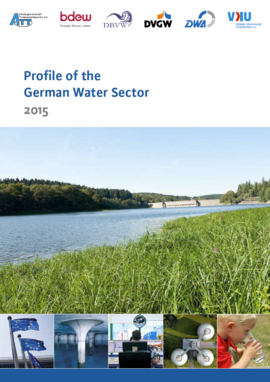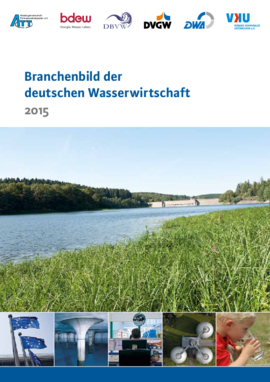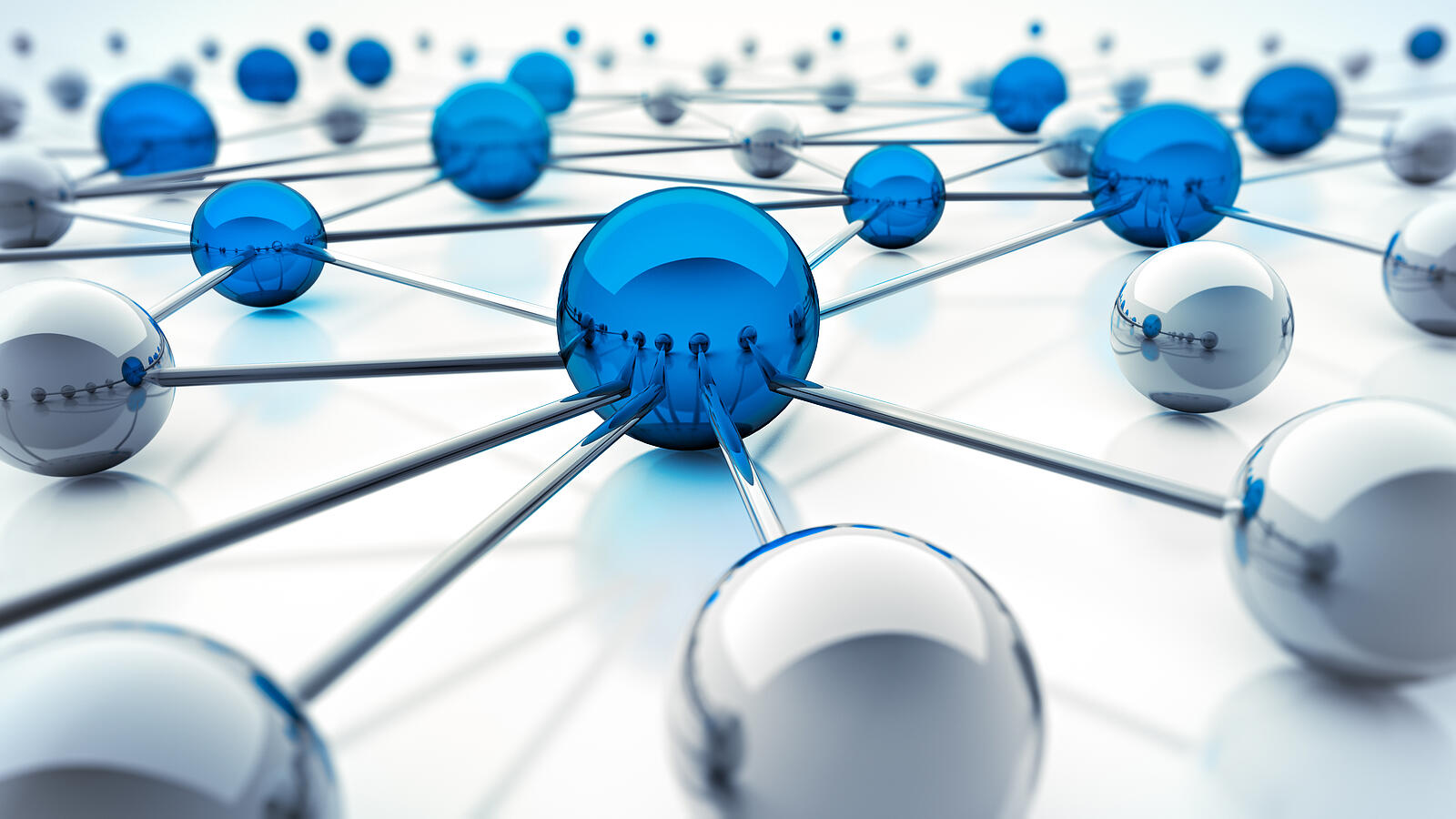
peterschreiber.media/stock.adobe.com
Infrastruktur und Dienstleistungen
Die kommunalen Unternehmen betreiben ein riesiges Infrastrukturnetzwerk und sind für dessen Aus- und Umbau verantwortlich.
Wir halten Deutschland am Laufen
Kommunale Unternehmen sind mit ihren effizienten und qualitativ hochwertigen Infrastrukturen das Fundament für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie garantieren die Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger in der Stadt und auf dem Land. Ihre Infrastrukturen sind für die Gesellschaft und Wirtschaft unentbehrlich. Sie sind ein Schatz unter der Straße. Dieses Vermögen sichert und pflegt die Kommunalwirtschaft. So halten die kommunalen Unternehmen Deutschland am Laufen.