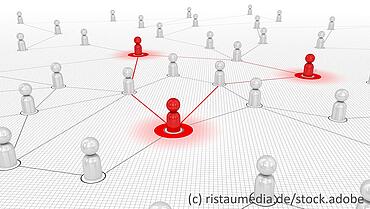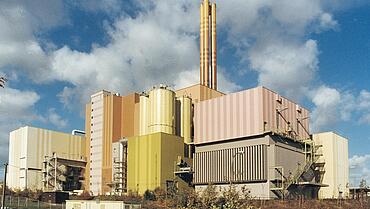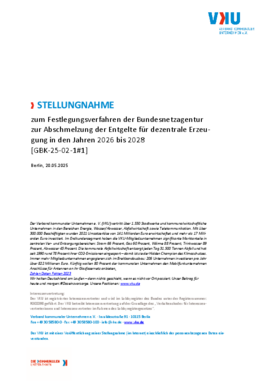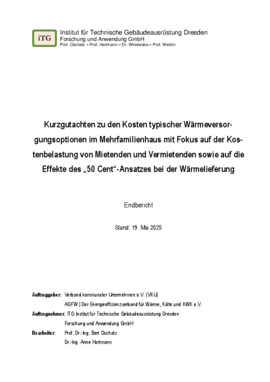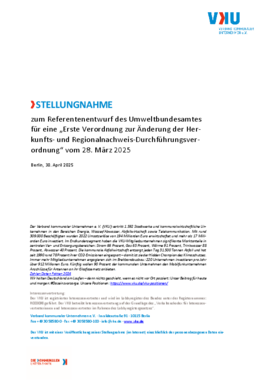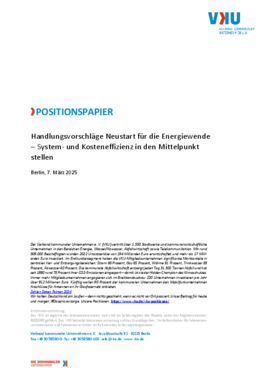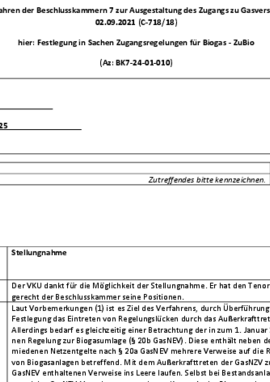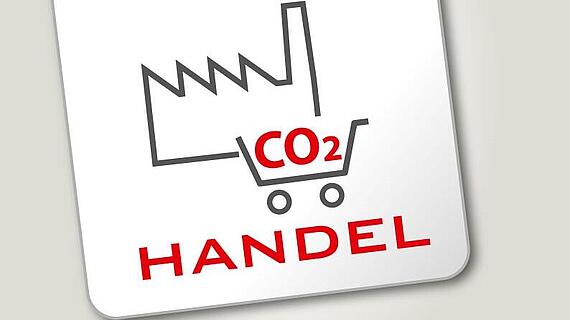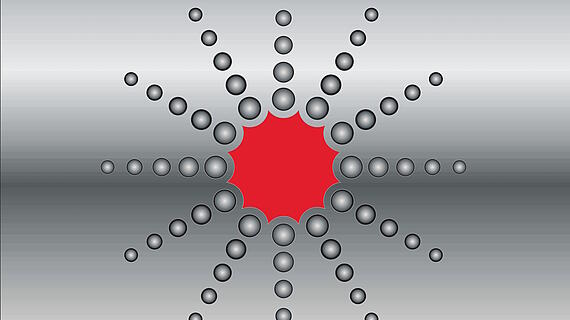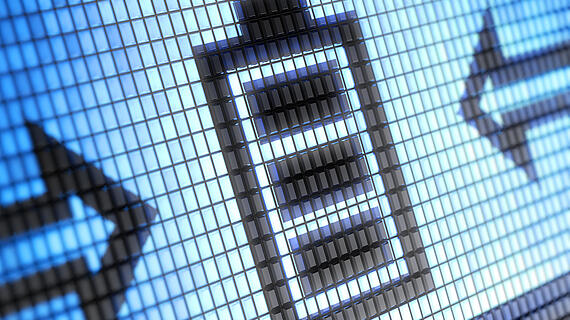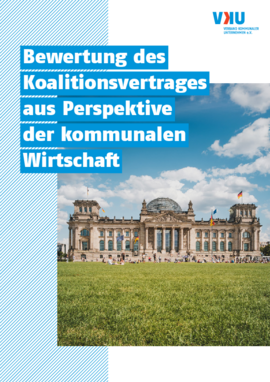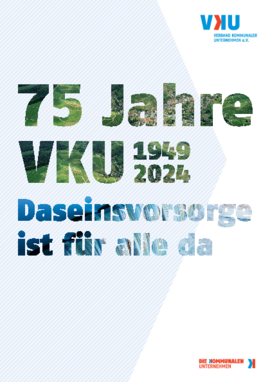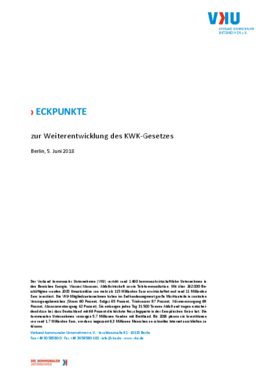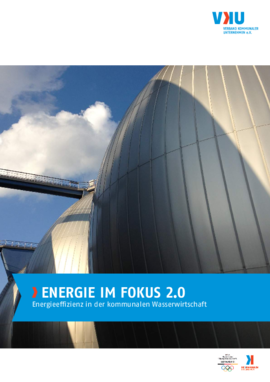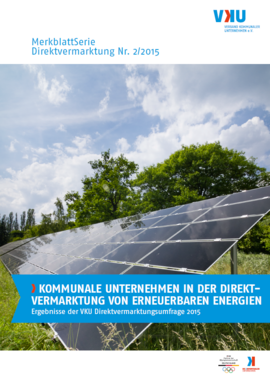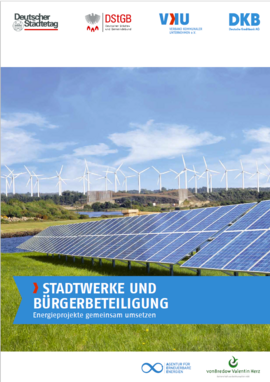Stockr/stock.adobe.com
Energiewende
Stadtwerke in Deutschland setzen die Energiewende vor Ort um. Sie sind die wichtigsten Akteure für deren Gelingen.
Wir treiben die Energiewende voran
Die Bundesregierung hat ehrgeizige Klimaziele verabschiedet, die nicht nur die Treibhausemission und den Einsatz erneuerbarer Energien betreffen. Gleichzeitig soll auch die Energieeffizienz gesteigert und der Energieverbrauch reduziert werden. Der VKU unterstützt die „Initiative Energieeffizienz-Netzwerk“ für mehrjährigen, systematischen und unbürokratischen Austausch der Unternehmen, um gemeinsam die Energieeffizienz zu steigern. Denn allein durch Umdenken beim Strom kann die Energiewende nicht gemeistert werden. Es braucht Investitionen im Wärmebereich sowie in der Sektorkopplung. Beide sind zentraler Lösungsansatz der Energiewende.