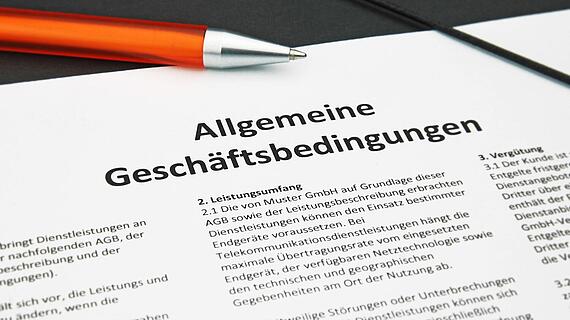Unlauterer Wettbewerb und Datenschutz
Datenschutz-Verstöße können wettbewerbsrechtlich verfolgt werden
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Verpflichtungen, wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche begründen und von Verbraucherschutzbänden und Wettbewerbern durch zivilrechtliche Klagen verfolgt werden kann.
09.04.25
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Verpflichtungen, wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche begründen und von Verbraucherschutzbänden und Wettbewerbern durch zivilrechtliche Klagen verfolgt werden kann.
Der BGH hat am 27.03.2025 im Verfahren I ZR 186/17 entschieden, dass ein Verstoß des Betreibers eines sozialen Netzwerks (in diesem Fall Facebook) gegen die datenschutzrechtliche Verpflichtung, die Nutzer dieses Netzwerks über Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu unterrichten, wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche begründet und von Verbraucherschutzbänden im Wege einer Klage vor den Zivilgerichten verfolgt werden kann. Eine persönliche Betroffenheit ist keine Voraussetzung. Ausreichend ist die Benennung einer Kategorie oder Gruppe von identifizierbaren natürlichen Personen.
Qualifizierten Einrichtungen steht danach gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Unterlassungsklagengesetzes (UKlaG) die Befugnis zu, wegen Verstößen gegen Informationspflichten gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 1 der Datenschutz-Grundversordnung (DSGVO) in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 Buchst. c und e DSGVO unabhängig von der konkreten Verletzung von Rechten einzelner betroffener Personen und ohne Auftrag einer betroffenen Person wegen Verstößen gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, ein Verbraucherschutzgesetz im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 13 UKlaG, und der Verwendung einer unwirksamen Allgemeinen Geschäftsbedingung gemäß § 1 UKlaG im Wege einer Klage vor den Zivilgerichten vorzugehen.
In dem Verstoß gegen die datenschutzrechtlichen Informationspflichten gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 1, Art. 13 Abs. 1 Buchst. c und e DSGVO liegt zugleich ein Verstoß gegen Lauterkeitsrecht unter dem Gesichtspunkt des Vorenthaltens einer wesentlichen Information gemäß § 5a Abs. 1 UWG.
Ausgehend von der wirtschaftlichen Bedeutung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten für internetbasierte Geschäftsmodelle, deren Nutzung der Verbraucher mit der Preisgabe personenbezogener Daten vergütet, kommt den Unterrichtungspflichten gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 1, Art. 13 Abs. 1 Buchst. c und e DSGVO zentrale Bedeutung zu, um sicherzustellen, dass der Verbraucher bei seiner mit einer Nachfrageentscheidung verknüpften Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten über Umfang und Tragweite dieser Einwilligungserklärung möglichst umfassend ins Bild gesetzt wird, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.
In zwei weiteren Verfahren (I ZR 222/19 und ZR 223/19) hat der BGH am 27.03.2025 zudem entschieden, dass die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die Mitbewerbern die Befugnis einräumt, wegen Verstößen gegen die DSGVO gegen den mutmaßlichen Verletzer im Wege einer wettbewerbsrechtlichen Klage vor den Zivilgerichten vorzugehen. Konkret ging es um einen Verstoß gegen die für Gesundheitsdaten geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, und dass ein solcher Verstoß von einem anderen Apotheker mit einer wettbewerbsrechtlichen Klage vor den Zivilgerichten verfolgt werden kann. Insoweit bewertet der BGH Art. 9 Abs. 1 DSGVO als Marktverhaltensregelung im Sinne von § 3a UWG. Die Bestimmungen zum Erfordernis der Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten dienen dem Schutz der Persönlichkeitsrechtsinteressen der Verbraucher gerade auch im Zusammenhang mit ihrer Marktteilnahme. Die Verbraucher sollen frei darüber entscheiden können, ob und inwieweit sie ihre Daten preisgeben, um am Markt teilnehmen und Verträge abschließen zu können.