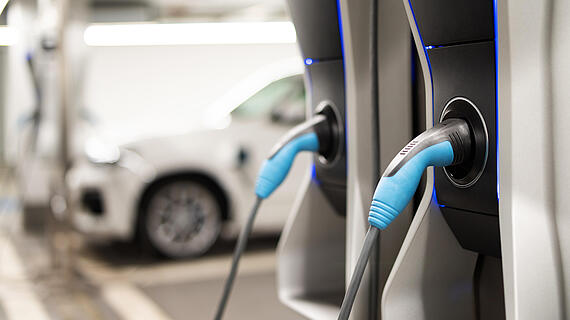Transformation der Gasnetze
Neue EnWG-Regeln setzen EU-Gaspaket um: wichtiger Schritt für klare Regeln bei der Gasnetztransformation
Stadtwerke und kommunale Unternehmen sind bereit, ihre Netze aktiv zu transformieren – hin zu Wasserstoff und klimaneutralen Gasen. Doch ohne klare Finanzierungsregeln und praxistaugliche Fristen droht die Transformation ins Stocken zu geraten.
27.11.25
Stadtwerke und kommunale Unternehmen sind bereit, ihre Netze aktiv zu transformieren – hin zu Wasserstoff und klimaneutralen Gasen. Doch ohne klare Finanzierungsregeln und praxistaugliche Fristen droht die Transformation ins Stocken zu geraten.

VKU nimmt zum EnWG-Referentenentwurf Stellung
Die Diskussion um die Zukunft unserer Gasnetze nimmt Fahrt auf. Der VKU hat seine Stellungnahme zum Referentenentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) veröffentlicht.
Die wichtigsten Punkte im Überblick
Wasserstoff als Schlüssel zur Energiewende Der VKU sieht Wasserstoff als unverzichtbaren Baustein für eine klimaneutrale Energieversorgung. Die bestehenden Gasverteilernetze – immerhin rund 530.000 Kilometer lang – sollen als Basis für künftige Wasserstoffnetze genutzt werden.
Pragmatische Regeln für Stilllegung und Anschluss Der VKU begrüßt die Pflicht zur Duldung stillgelegter Leitungen, fordert aber Nachschärfungen. Ebenso kritisiert er die starre Informationsfrist von zehn Jahren für Netztrennungen – fünf Jahre wären realistischer.
Mehr Flexibilität bei Entwicklungsplänen Netzbetreiber sollen ihre Verteilernetzentwicklungspläne regelmäßig aktualisieren können. Der VKU unterstützt dies genauso wie die Möglichkeit für gemeinsame regionale Planungen, um Bürokratie zu reduzieren und Synergien zu nutzen.
Transparenz ja, Bürokratie nein Während der VKU mehr Transparenz am Gas- und Wasserstoffmarkt befürwortet, warnt er vor überbordenden Berichtspflichten. Außerdem müsse der Schutz kritischer Infrastrukturen gewährleistet bleiben.
Speicher und internationale Märkte Positiv bewertet der Verband die geplante Regulierung für Wasserstoffspeicher ab 2026. Gleichzeitig mahnt er, dass der grenzüberschreitende Handel nicht zulasten heimischer Biogasproduktion gehen darf.
Finanzierungsmechanismus dringend nötig Ein zentrales Problem: Für Wasserstoffnetze außerhalb des Kernnetzes fehlt bislang ein klarer Finanzierungsrahmen. Ohne diesen müssten Netzbetreiber das volle Risiko tragen – ein Hemmschuh für Investitionen und den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft.
VKU-Kernforderungen zur Finanzierung von Wasserstoffnetzen
Finanzierungsmechanismus auch für Verteilernetze Klare Regeln müssen geschaffen werden, nicht nur für das Wasserstoff-Kernnetz.
Intertemporale Kostenallokation gesetzlich verankern, damit Kosten nicht sofort und vollständig auf die aktuellen Netznutzer verteilt werden, sondern über einen längeren Zeitraum gestreckt werden.
Transferregelungen schaffen: Die EU ermöglicht den Mitgliedstaaten, interne Finanztransfers zwischen den regulierten Gas- und Wasserstoffnetzbereichen zu erlauben – wenn die Regulierungsbehörde feststellt, dass die Finanzierung betreffender Netze über Netzzugangsentgelte, die nur von den jeweiligen Netznutzern gezahlt werden, nicht tragfähig ist. Deutschland sollte diesen Spielraum ausschöpfen.
Risikoteilung statt Alleinlast Netzbetreiber dürfen nicht das volle Investitionsrisiko tragen – der Staat muss beteiligt werden.
Planungssicherheit Verbindliche Vorgaben sind nötig, damit Investitionen kalkulierbar und langfristig abgesichert sind.
Vermeidung von Investitionsstau Ohne Finanzierung drohen Projekte außerhalb des Kernnetzes zu stocken oder ganz auszufallen.
Integration in Regulierungssysteme Kosten für Transformation und Stilllegung müssen fair und transparent in die Erlösobergrenzen eingepreist werden.
Und für die Stilllegung? Kompensationskonto einrichten, um die Transformation der Gasnetze sozialverträglich und wirtschaftlich abzusichern. Es soll Netzbetreibern die Sicherheit geben, dass Stilllegungskosten sozialverträglich refinanziert werden – und damit Investitionen in Wasserstoff- und alternative Netze nicht blockiert werden
Der VKU macht deutlich: Die Transformation der Gasnetze ist nicht nur eine technische, sondern auch eine politische und finanzielle Herausforderung. Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, braucht es einen verlässlichen Rechtsrahmen, der Investitionen ermöglicht und Planungssicherheit schafft.