VKU-Stellungnahmen
VKU-Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2024/1788 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung einer Methodik zur Bewertung der Treibhausgaseinsparungen durch kohlenstoffarme Brennstoffe vom 29.04.202
09.07.25
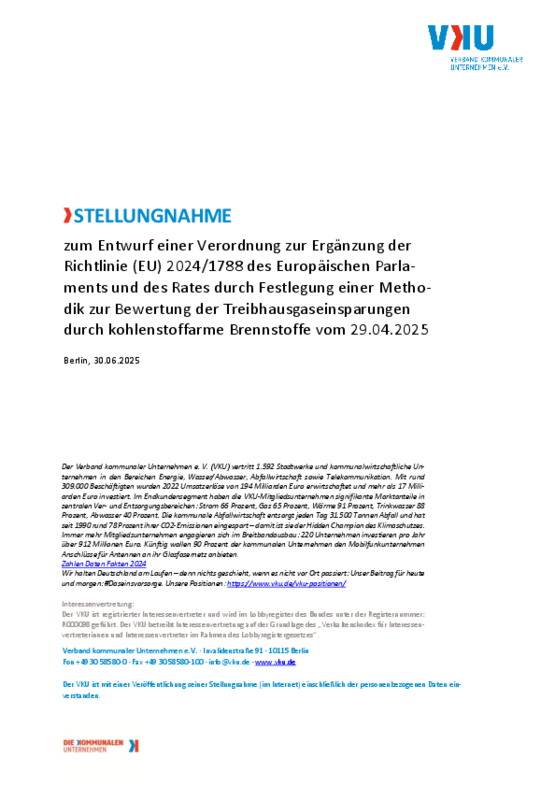
Positionen des VKU in Kürze
- Notwendig ist ein Fokus auf Kosteneffizienz und Pragmatismus sowie eine enge europäische Koordination und gezielte Fördermechanismen.
- Die Ausgestaltung der Vorgaben im vorliegenden Verordnungsentwurf basierend auf der CO2-Intensität des Stromsystems ist grundsätzlich sinnvoll, darf jedoch nicht unerfüllbar sein.
- Notwendig ist die Option der durchschnittlichen stündlichen CO2-Intensität zu nutzen.
- Die Methodik erlaubt nur unzureichend, bessere THG-Leistungen über alle Prozessschritte hinweg darzustellen.
- Die Anforderungen der Verordnung müssen so gestaltet werden, dass sie die zu-verlässige Entwicklung des Marktes für Wasserstoff fördern und nicht behindern.
- Durch die strengen Kriterien im Verordnungsentwurf werden innovative Verfahren wie die Methanpyrolyse faktisch ausgeschlossen.
- Der VKU empfiehlt, die Methode der durchschnittlichen stündlichen CO2-Intensität des Stromsystems auf den Erneuerbare-Energien-Anteil des Stromsystems zu übertragen und in der Delegierten Verordnung 2023/1184 zu Grünem Wasserstoff als zusätzliche Nachweisoption zu verankern, weil die bisher zur Verfügung stehenden Nachweisoptionen viel zu restriktiv sind. Im Zuge des vorliegenden Verordnungsentwurfs sollte eine entsprechende Ergänzung der delegierten Ver-ordnung 2023/1184 zu Grünem Wasserstoff vorgenommen werden.
Hintergrund zum Verordnungsentwurf
Die Verordnung ergänzt die Richtlinie (EU) 2024/1788 über gemeinsame Regeln für die Märkte für erneuerbares Gas, Erdgas und Wasserstoff. Sie legt eine Methodik zur Berechnung der Treibhausgaseinsparungen von kohlenstoffarmen (low-carbon) Brennstoffen (z.B. blauer H2) fest. Ziel ist es, eine einheitliche, transparente und vergleichbare Bewertung der Klimawirkung solcher Brennstoffe zu ermöglichen – insbesondere im Hinblick auf:
- Lebenszyklusemissionen (inkl. Methanemissionen und CO₂-Abscheidung),
- indirekte Emissionen durch Umleitung von Rohstoffen,
- Konsistenz mit bestehenden Regelungen für erneuerbare und recycelte Brennstoffe.